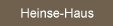Mutter Erde! Tränk in meiner Aue
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Seite
vor
zurück
vor
zurück
Johann Jakob Wilhelm Heinse wurde am 15 Februar 1746 in Langewiesen geboren, einer kleinen Stadt bei Ilmenau in Thüringen. Sein Vater war dort Stadtschreiber (später auch Bürgermeister) und Organist. Trotzdem wuchs der junge Heinse in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. In Jena und Erfurt, wo er Jura studierte, hatte er doch das Glück, großzügige, einflussreiche und ihm wohl gesonnene Gönner zu treffen, wie Professor Friedrich Justus Riedel oder Christoph Martin Wieland, einen der damals angesehensten Schriftsteller, und später auch den beliebten Dichter Johann Wilhelm Gleim.
Ruhm – wenn auch einen etwas eigenartigen – erreicht Heinse ziemlich früh, freilich nicht durch eine eigene Schrift. 1773 veröffentlicht er nämlich eine Übersetzung des Satyricon von Petronius, eines Werkes, das den etwas zwielichtigen Ruf eines Romans von geradezu pornographischem Charakter genießt. Die Übersetzung Heinses hält man für meisterhaft, doch sie wird zu einem Sittenskandal und der empörte Wieland bezichtigt den Übersetzer eines „Seelenpriapismus“. Eine Zeitlang ist Heinse gezwungen unter Pseudonym zu publizieren und wird das Etikett eines Skandalautors nicht mehr los, das er übrigens schon aus eigenener Wahl auch später noch bestätigen wird. Denn ähnliche Reaktionen löste ein Jahr später sein erster eigener Roman, Laidion oder die eleusinischen Geheimnisse, aus. Dem Werk sind 56 Stanzen angeschlossen, von denen Wieland meint, dass sie „nur von Hurenwirten und Bordellnymphen mit Beifall gelesen [...] werden“[2], aber Goethe, den Heinse im Juli desselben Jahres in Pempelfort bei Düsseldorf kennen lernt, verbirgt seine Bewunderung nicht und beschenkt den Autor mit dem höchsten denkbaren Kompliment: Bei der Lektüre mancher Stellen habe er den Eindruck, als ob er sie selbst geschrieben hätte. Und an Gottlob Friedrich Ernst Schönborn schreibt er am 4. Juli 1774: „Laidion oder die eleusinischen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben, und lässt Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Vortrags, auch die Ideen Welt in denen sich's herumdreht mit den ihrigen coinzidirt. Hinten an sind Ottave angedruckt die alles übertreffen was je mit Schmelzfarben gemahlt worden.”[3]
Die nächste Station auf dem unruhigen Lebensweg Heinses, der inzwischen schon Hauslehrer war und sogar – erfolglos – eine Geldlotterie zu gründen versuchte, ist Düsseldorf, wo er von 1774 bis 1780 mit der „Iris“, einer Zeitschrift für elegante Damenwelt zusammenarbeitet, die von Johann Georg Jacobi herausgegeben wird, dem Bruder des damals berühmten Philosophen und Publizisten Friedrich Heinrich, des Urhebers vom Begriff des „Nihilismus“, wohlgemerkt. Und im „Teutschen Merkur“, dessen Herausgeber Wieland ist, der zwar die translatorischen und schriftstellerischen Unternehmungen seines ehemaligen Günstlings missbilligt, aber ihn immer noch schätzt und eine gewisse Sympathie für ihn empfindet, erscheint gleichzeitig eine Reihe ausgezeichneter ästhetischer Skizzen Heinses, die den Gemälden der Düsseldorfer Galerie gewidmet sind, vor allem denen von Raffael und Rubens.
Es gibt damals zwei Länder, von denen zumindest eines (am besten aber beide) ein deutscher Künstler oder Literat unbedingt besuchen soll – England und Italien. England gilt als die Wiege der Aufklärung, das Vaterland des freien Gedankens, des wissenschaftlichen Fortschritts und des Parlamentarismus, mit allen seinen Gebrechen, so scharfsinnig von Georg Christoph Lichtenberg beschrieben, der die Beratungen des Unterhauses aufmerksam verfolgt. Italien wird dagegen als ein riesengroßes Museum angesehen, wo man wohl am besten das antike Erbe konserviert hat, das wahre Vaterland aller schöpferischen Geister. Hier und da lassen sich freilich skeptische Stimmen vernehmen. Johann Wilhelm von Archenholtz stellt in seinem 1785 herausgegebenen Buch England und Italien einen Vergleich zwischen beiden Ländern an, wobei er ein recht niederschmetterndes Urteil über das letztere fällt, dem zufolge Italien eine Art hinterbliebenes Freilichtmuseum ist, bewohnt von einer demoralisierten, ungebildeten und gegen den katholischen Klerus blind gehorsamen Gesellschaft. Diese Auslassungen nimmt allerdings kaum jemand ernst. Das Land, „wo die Zitronen blühen“, bleibt nach wie vor das Ziel beinahe obligatorischer Pilgerfahrten von Künstlern aus ganz Europa. Als Goethe 1786 seine Italienreise antritt, will er seine „Existenz ganzer (...) machen“[4] und den „klassischen Boden“ unter die Füße bekommen. Ein solches Bild Italiens als einer Schatzkammer der Antike hat der allgemein angesehene Historiker der antiken Kunst, Johann Joachim Winckelmann, geprägt. Als jedoch 1780 Heinse seine erträumte Reise nach Süden beginnt, ist der Gegenstand seines Interesses vor allem die italienische Renaissance. Er bewundert antike Bauten, aber sklavisches Nachahmen der Alten, von Winckelmann so empfohlen, ist in seiner Sicht ein Weg nach Nirgendwo. Zumal Winckelmann zu Hauptmerkmalen der antiken Kunst „eine edle Einfalt und eine stille Größe“[5] bestimmt, das heißt jenes sozusagen „apollinische“ Element des
griechischen Altertums. Dagegen sucht Heinse vielmehr dessen „dionysisches“ Wesen – auch wenn er es noch nicht so nennt – das,
wie er glaubt, in vollem Maße eben von der italienischen Renaissance wiederentdeckt wurde.
Ruhm – wenn auch einen etwas eigenartigen – erreicht Heinse ziemlich früh, freilich nicht durch eine eigene Schrift. 1773 veröffentlicht er nämlich eine Übersetzung des Satyricon von Petronius, eines Werkes, das den etwas zwielichtigen Ruf eines Romans von geradezu pornographischem Charakter genießt. Die Übersetzung Heinses hält man für meisterhaft, doch sie wird zu einem Sittenskandal und der empörte Wieland bezichtigt den Übersetzer eines „Seelenpriapismus“. Eine Zeitlang ist Heinse gezwungen unter Pseudonym zu publizieren und wird das Etikett eines Skandalautors nicht mehr los, das er übrigens schon aus eigenener Wahl auch später noch bestätigen wird. Denn ähnliche Reaktionen löste ein Jahr später sein erster eigener Roman, Laidion oder die eleusinischen Geheimnisse, aus. Dem Werk sind 56 Stanzen angeschlossen, von denen Wieland meint, dass sie „nur von Hurenwirten und Bordellnymphen mit Beifall gelesen [...] werden“[2], aber Goethe, den Heinse im Juli desselben Jahres in Pempelfort bei Düsseldorf kennen lernt, verbirgt seine Bewunderung nicht und beschenkt den Autor mit dem höchsten denkbaren Kompliment: Bei der Lektüre mancher Stellen habe er den Eindruck, als ob er sie selbst geschrieben hätte. Und an Gottlob Friedrich Ernst Schönborn schreibt er am 4. Juli 1774: „Laidion oder die eleusinischen Geheimnisse. Es ist mit der blühendsten Schwärmerei der geilen Grazien geschrieben, und lässt Wieland und Jacobi weit hinter sich, obgleich der Ton und die Art des Vortrags, auch die Ideen Welt in denen sich's herumdreht mit den ihrigen coinzidirt. Hinten an sind Ottave angedruckt die alles übertreffen was je mit Schmelzfarben gemahlt worden.”[3]
Die nächste Station auf dem unruhigen Lebensweg Heinses, der inzwischen schon Hauslehrer war und sogar – erfolglos – eine Geldlotterie zu gründen versuchte, ist Düsseldorf, wo er von 1774 bis 1780 mit der „Iris“, einer Zeitschrift für elegante Damenwelt zusammenarbeitet, die von Johann Georg Jacobi herausgegeben wird, dem Bruder des damals berühmten Philosophen und Publizisten Friedrich Heinrich, des Urhebers vom Begriff des „Nihilismus“, wohlgemerkt. Und im „Teutschen Merkur“, dessen Herausgeber Wieland ist, der zwar die translatorischen und schriftstellerischen Unternehmungen seines ehemaligen Günstlings missbilligt, aber ihn immer noch schätzt und eine gewisse Sympathie für ihn empfindet, erscheint gleichzeitig eine Reihe ausgezeichneter ästhetischer Skizzen Heinses, die den Gemälden der Düsseldorfer Galerie gewidmet sind, vor allem denen von Raffael und Rubens.
Es gibt damals zwei Länder, von denen zumindest eines (am besten aber beide) ein deutscher Künstler oder Literat unbedingt besuchen soll – England und Italien. England gilt als die Wiege der Aufklärung, das Vaterland des freien Gedankens, des wissenschaftlichen Fortschritts und des Parlamentarismus, mit allen seinen Gebrechen, so scharfsinnig von Georg Christoph Lichtenberg beschrieben, der die Beratungen des Unterhauses aufmerksam verfolgt. Italien wird dagegen als ein riesengroßes Museum angesehen, wo man wohl am besten das antike Erbe konserviert hat, das wahre Vaterland aller schöpferischen Geister. Hier und da lassen sich freilich skeptische Stimmen vernehmen. Johann Wilhelm von Archenholtz stellt in seinem 1785 herausgegebenen Buch England und Italien einen Vergleich zwischen beiden Ländern an, wobei er ein recht niederschmetterndes Urteil über das letztere fällt, dem zufolge Italien eine Art hinterbliebenes Freilichtmuseum ist, bewohnt von einer demoralisierten, ungebildeten und gegen den katholischen Klerus blind gehorsamen Gesellschaft. Diese Auslassungen nimmt allerdings kaum jemand ernst. Das Land, „wo die Zitronen blühen“, bleibt nach wie vor das Ziel beinahe obligatorischer Pilgerfahrten von Künstlern aus ganz Europa. Als Goethe 1786 seine Italienreise antritt, will er seine „Existenz ganzer (...) machen“[4] und den „klassischen Boden“ unter die Füße bekommen. Ein solches Bild Italiens als einer Schatzkammer der Antike hat der allgemein angesehene Historiker der antiken Kunst, Johann Joachim Winckelmann, geprägt. Als jedoch 1780 Heinse seine erträumte Reise nach Süden beginnt, ist der Gegenstand seines Interesses vor allem die italienische Renaissance. Er bewundert antike Bauten, aber sklavisches Nachahmen der Alten, von Winckelmann so empfohlen, ist in seiner Sicht ein Weg nach Nirgendwo. Zumal Winckelmann zu Hauptmerkmalen der antiken Kunst „eine edle Einfalt und eine stille Größe“[5] bestimmt, das heißt jenes sozusagen „apollinische“ Element des
griechischen Altertums. Dagegen sucht Heinse vielmehr dessen „dionysisches“ Wesen – auch wenn er es noch nicht so nennt – das,
wie er glaubt, in vollem Maße eben von der italienischen Renaissance wiederentdeckt wurde.




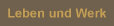




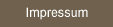
J.J.Wilhelm Heinse