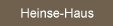Mutter Erde! Tränk in meiner Aue
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Seite
vor
zurück
vor
zurück
Diotima
Du schweigst und duldest, und sie versteh'n dich nicht,
Du heilig Leben! welkest hinweg und schweigst,
Denn ach, vergebens bei Barbaren
Suchst du die Deinen im Sonnenlichte,
Die zärtlichgroßen Seelen, die nimmer sind!
Doch eilt die Zeit. Noch siehet mein sterblich Lied
Den Tag, der, Diotima! nächst den
Göttern mit Helden dich nennt, und dir gleicht.
StA, Band 1, Seite 242.
Im September 1798 musste Hölderlin das Haus Gontard verlassen. Sein Liebesverhältnis mit Susette war untragbar geworden. Er ging auf Einladung von Sinclair nach Bad Homburg. Einige Male sahen sich die Geliebten noch und tauschten auch Briefe aus. In Frankfurt verbrachte er wohl die schönsten Jahre seines Lebens. In Homburg versuchte er seinen Abschiedsschmerz zu vergessen. Er rettete sich in den Gedanken, dass eine tiefe und dauerhafte Bindung zwischen Liebenden nicht unbedingt eine räumliche Nähe verlangt. In seinen Oden und Elegien hielt Hölderlin seine Liebe lebendig, bewahrte ihr Bild und überwandt schließlich seinen Schmerz und erhob seine Diotima ins Überirdische und stellte sie den Musen und Halbgöttern gleich.
Er fühlte aber auch noch eine andere Aufgabe in sich. Sie gab ihm immer wieder Auftrieb, nämlich der heilige Auftrag, volkserzieherisch und politisch zu wirken.
Die zwei Jahre im Hause bei J. Sinclair (1798-1800) nach der Trennung von Susette waren für ihn eine sehr produktive Zeit. Er nahm sich vor, in Jena Vorlesungen zu halten (bemühte Schiller). Er dachte auch daran, eine Zeitschrift herauszugeben. Seinen Roman „Hyperion“ gab er in den Druck und er arbeitete an seinem Trauerspiel „Der Tod des Empedokles“. Es ging ihm vorrangig darum, ein selbständiger und unabhängiger Dichter zu werden. Er wollte sich von den z.T. entehrenden Hofmeisterstellungen und von den finanziellen Unterstützungen durch seine Mutter lösen. Beides gelang ihm zeitlebens nicht !
Der Glaube an sich und seine Zeit ging langsam verloren. Ein weiterer Grund für seine Zerrissenheit und seine Zweifel war das Gefühl, vor seiner Mutter versagt zu haben. Diese drängte ihn sein ganzes Leben, Pfarrer zu werden und von der Dichtkunst abzulassen.
Obwohl er in Bad Homburg gesundheitlich eine stabile Zeit erlebte, waren die Anzeichen seiner Krankheit vorhanden.
Hölderlin erkannte seinen Zustand und teilte den in mehreren Briefen mit. Wie sehr er litt und wie sehr er Halt und
Hoffnung suchte, macht sein Gedicht „Abendphantasie“ deutlich.
1800 wurde von ihm die Ode „Heidelberg“ in ihre endgültige Fassung gebracht. Er hatte die Stadt einige Male besucht.
Du schweigst und duldest, und sie versteh'n dich nicht,
Du heilig Leben! welkest hinweg und schweigst,
Denn ach, vergebens bei Barbaren
Suchst du die Deinen im Sonnenlichte,
Die zärtlichgroßen Seelen, die nimmer sind!
Doch eilt die Zeit. Noch siehet mein sterblich Lied
Den Tag, der, Diotima! nächst den
Göttern mit Helden dich nennt, und dir gleicht.
StA, Band 1, Seite 242.
Im September 1798 musste Hölderlin das Haus Gontard verlassen. Sein Liebesverhältnis mit Susette war untragbar geworden. Er ging auf Einladung von Sinclair nach Bad Homburg. Einige Male sahen sich die Geliebten noch und tauschten auch Briefe aus. In Frankfurt verbrachte er wohl die schönsten Jahre seines Lebens. In Homburg versuchte er seinen Abschiedsschmerz zu vergessen. Er rettete sich in den Gedanken, dass eine tiefe und dauerhafte Bindung zwischen Liebenden nicht unbedingt eine räumliche Nähe verlangt. In seinen Oden und Elegien hielt Hölderlin seine Liebe lebendig, bewahrte ihr Bild und überwandt schließlich seinen Schmerz und erhob seine Diotima ins Überirdische und stellte sie den Musen und Halbgöttern gleich.
Er fühlte aber auch noch eine andere Aufgabe in sich. Sie gab ihm immer wieder Auftrieb, nämlich der heilige Auftrag, volkserzieherisch und politisch zu wirken.
Die zwei Jahre im Hause bei J. Sinclair (1798-1800) nach der Trennung von Susette waren für ihn eine sehr produktive Zeit. Er nahm sich vor, in Jena Vorlesungen zu halten (bemühte Schiller). Er dachte auch daran, eine Zeitschrift herauszugeben. Seinen Roman „Hyperion“ gab er in den Druck und er arbeitete an seinem Trauerspiel „Der Tod des Empedokles“. Es ging ihm vorrangig darum, ein selbständiger und unabhängiger Dichter zu werden. Er wollte sich von den z.T. entehrenden Hofmeisterstellungen und von den finanziellen Unterstützungen durch seine Mutter lösen. Beides gelang ihm zeitlebens nicht !
Der Glaube an sich und seine Zeit ging langsam verloren. Ein weiterer Grund für seine Zerrissenheit und seine Zweifel war das Gefühl, vor seiner Mutter versagt zu haben. Diese drängte ihn sein ganzes Leben, Pfarrer zu werden und von der Dichtkunst abzulassen.
Obwohl er in Bad Homburg gesundheitlich eine stabile Zeit erlebte, waren die Anzeichen seiner Krankheit vorhanden.
Hölderlin erkannte seinen Zustand und teilte den in mehreren Briefen mit. Wie sehr er litt und wie sehr er Halt und
Hoffnung suchte, macht sein Gedicht „Abendphantasie“ deutlich.
1800 wurde von ihm die Ode „Heidelberg“ in ihre endgültige Fassung gebracht. Er hatte die Stadt einige Male besucht.




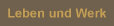




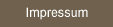
J.J.Wilhelm Heinse