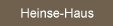Mutter Erde! Tränk in meiner Aue
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Seite
vor
zurück
vor
zurück
In Tübingen gründete Hölderlin mit gleichgesinnten Studenten einen Dichterbund. Ch.L.Neuffer (blieb sein lebenslanger Freund und Briefpartner) und die späteren Philosophen Hegel und Schelling gehörten dazu. In „empfindsamer Seelengemeinschaft“ wurde gedichtet, vorgetragen und gesungen. Die Ideale der Großen Französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit machten auch vor den Stiftsmauern nicht halt und begeisterten die Studenten, natürlich besonders Hölderlin. Schiller war jetzt und in den folgenden Jahren mit seinen Hymnen für Hölderlin ein bestimmendes Vorbild. In Hölderlins früher Lyrik sind Schillers Begeisterung und Pathos zu erkennen („Hymne der Liebe“, „Lied der Freundschaft“, „Hymne an die Menschlichkeit“). Mit seien Hymnen hoffte Hölderlin auch auf die Anerkennung durch Schiller.
Hölderlin begann auch gegen Ende seiner Stiftszeit mit der Arbeit an seinem Briefroman „Hyperion“. Dabei wurde seine Liebe zur Antike, zu Griechenland und seine Verbundenheit mit deren klassischen Dichtern, u.a. mit Platon lebendig. Die Tübinger Zeit ging zu Ende, er legte sein Examen ab und entschied sich, keine theologische Laufbahn einzuschlagen. Hegel ging bereits den anderen Weg, er wurde in Bern „Hofmeister“. Schiller veröffentlichte einige Verse von Hölderlin und vermittelte ihm eine Hofmeisterstelle bei der Familie von Kalb in Waltershausen in Unterfranken (Nähe Königshofen).
Neben seinem Unterricht blieb genug Zeit, sein Wissen weiter zu vertiefen. Herder, Kant, Fichte u.a. fesselten seine Aufmerksamkeit und er nahm die Arbeit an seinem Roman „ Hyperion oder der Eremit in Griechenland“ (97-99) wieder auf. Im Herbst 1794 schickte er das Fragment von „Hyperion“ an Schiller. Mit der Erziehung seines Zöglings ging es nicht gut voran. Schüler und Lehrer fuhren gemeinsam nach Jena. Hölderlin besuchte öfter Schiller, der ihn zunächst freundlich entgegenkam. Das Verhältnis wurde jedoch immer konfliktreicher. Schiller orientierte sich mehr und mehr an Goethe und beide Klassiker nahmen z. Teil wesentlich andere Positionen ein als Hölderlin, sie trennten die Kunst von der praktisch – revolutionären Tat. Goethe hatte ihn bei Schiller in Jena nahezu übersehen. In Jena war er zuerst von Fichte begeistert. Aber bald wendete er sich von dessen radikalen Forderungen ab. In Weimar kommt es zur Auflösung seines Hofmeisterverhältnisses. Es folgte förmlich eine „Flucht“ aus Jena. Er wollte frei von den starken, prägenden Eindrücken Fichtes und Schillers leben und seine eigene poetische Bestimmung finden. Das Gedicht „An die klugen Ratgeber“ hat Schiller später nicht drucken lassen. Den ständigen Wunsch seiner Mutter, in der Nähe seines Heimatortes eine Pfarrstelle anzutreten, lehnt Hölderlin zum wiederholten Male ab.
Hölderlin begann auch gegen Ende seiner Stiftszeit mit der Arbeit an seinem Briefroman „Hyperion“. Dabei wurde seine Liebe zur Antike, zu Griechenland und seine Verbundenheit mit deren klassischen Dichtern, u.a. mit Platon lebendig. Die Tübinger Zeit ging zu Ende, er legte sein Examen ab und entschied sich, keine theologische Laufbahn einzuschlagen. Hegel ging bereits den anderen Weg, er wurde in Bern „Hofmeister“. Schiller veröffentlichte einige Verse von Hölderlin und vermittelte ihm eine Hofmeisterstelle bei der Familie von Kalb in Waltershausen in Unterfranken (Nähe Königshofen).
Neben seinem Unterricht blieb genug Zeit, sein Wissen weiter zu vertiefen. Herder, Kant, Fichte u.a. fesselten seine Aufmerksamkeit und er nahm die Arbeit an seinem Roman „ Hyperion oder der Eremit in Griechenland“ (97-99) wieder auf. Im Herbst 1794 schickte er das Fragment von „Hyperion“ an Schiller. Mit der Erziehung seines Zöglings ging es nicht gut voran. Schüler und Lehrer fuhren gemeinsam nach Jena. Hölderlin besuchte öfter Schiller, der ihn zunächst freundlich entgegenkam. Das Verhältnis wurde jedoch immer konfliktreicher. Schiller orientierte sich mehr und mehr an Goethe und beide Klassiker nahmen z. Teil wesentlich andere Positionen ein als Hölderlin, sie trennten die Kunst von der praktisch – revolutionären Tat. Goethe hatte ihn bei Schiller in Jena nahezu übersehen. In Jena war er zuerst von Fichte begeistert. Aber bald wendete er sich von dessen radikalen Forderungen ab. In Weimar kommt es zur Auflösung seines Hofmeisterverhältnisses. Es folgte förmlich eine „Flucht“ aus Jena. Er wollte frei von den starken, prägenden Eindrücken Fichtes und Schillers leben und seine eigene poetische Bestimmung finden. Das Gedicht „An die klugen Ratgeber“ hat Schiller später nicht drucken lassen. Den ständigen Wunsch seiner Mutter, in der Nähe seines Heimatortes eine Pfarrstelle anzutreten, lehnt Hölderlin zum wiederholten Male ab.




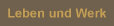




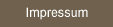
J.J.Wilhelm Heinse