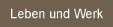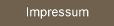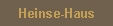Mutter Erde! Tränk in meiner Aue
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Seite
vor
zurück
vor
zurück
,,Heinse”, schreibt Friedrich Hebbel 1840 ins Tagebuch, ,,ist eine Feuerwolke, die Deutschland erst dann am Himmel bemerkte, nachdem sie durch einen ihrer Blitze ein paar elende Bauernhütten in Brand gesteckt hatte.”
Ach, in solch jupitersattem Szenario hätte sich lediglich der auf dem Emanzipationstrip wandelnde junge Heinse wiedergefunden, als er noch der scherzhaften Muse, die sich in rokokohaften Tändeleien gefiel, die Flötentöne austrieb. Statt über säuselnder Winde und buschwindröschenhaftem Voyerismus, wie es in seiner Jugend poetisch en vouge war, macht sich Heinse einen Reim auf orgiastische ,,Regengüsse” und blutspritzende ,,Liebesbisse”. Und merkt sehr schnell, wie einem der Ruf des Erotomanen schadet. Es dauert dreißig Jahre, bis ein gewisser Heinrich von Kleist Heinses lyrischen Geschlechterkampf poetisch überbietet -
und mit dem Liebesmord seiner Amazonenkönig Penthesilea ebensowenig Gnade findet in den Augen des literarischen Trendsetters Goethe wie seinerzeit Heinse bei seinem Mentor Wieland. Der hatte Heinses Vorwurf gegenüber seiner Rokoko-Erotik ebenso gut verstanden, wie Goethe in Kleists Drama nun den trotzigen Gegenentwurf zu seiner Iphigenie sah. Avantgarde sein, künstlerisch zumal, kann lebenszehrend sein.
Heinse jedoch flüchtet sich nicht in den Wahnsinn, aber zunehmend ins ästhetische Exil, in die Abstraktion der Darstellung und in eine Art selbstgewählten Autismus.
,,Hofmeister wurden viele, Minister nur wenige”, lautet der fast sardonische Kommentar zum Schicksal deutscher Literaten der Goethezeit in einer neueren Literaturgeschichte.
Wenn wir Heinses Lebens- und Arbeitsweise als Zeichen gefährdeter Individualität lesen, so sind wir auch hier einem typischen Schicksal der Epoche begegnet - einem innerlich Exilierten, der seine glückseligen Inseln vor allem im Ästhetischen gefunden hat.
Dabei hat Wilhelm Heinse - durch die verschiedensten Lebenserfahrungen früh geprägt -niemals die Kunst als höchste Instanz oder als Kompensationsobjekt einer entgötterten Moderne gepriesen. Wer zu tief im realen Schlamassel steckt, bleibt gewöhnlich skeptisch gegenüber den Rauschmitteln des Idealismus - den großen Theoremen der Politik, Philosophie und Kunst. -
Heinses an die frühe griechische Naturphilosophie angelehntes Ich- und Weltverständnis begreift die Welt als das auseinandergefaltete Wesen, als die in stets neuen Formen mit sich selbst spielende Gottheit. Nach Heinse muß die Welt als göttliches Spiel erfaßt werden, dem die eigene Existenz beizugeben ist.
Eine entsprechend vollkommene, teils einfühlsame teils ins Hymnische sich steigernde Sprache, aus der noch die Vertreter des literarische Expressionismus wie Impressionismus schöpfen werden, findet Heinse auch für seine Naturbilder, für alle Erlebnisse, in denen er sein naturhaftes Vollkommenheitsideal manifestiert sieht.
Die pantheistisch intendierte Ersetzung eines verlorenen personifizierten Gottesbegriffs ist typisch für die Intellektuellen des achtzehnten Jahrhunderts. Eine göttlich durchwaltete Natur hat sich als fixer, das meint: rational nicht hinterfragter Begriff in die traditionelle Theologie hineingedrängt.
Man reißt ihr keine Erklärungen vom Leibe, sagt etwa Goethe über diese Natur. ,,Sie ist alles, ich vertraue mich ihr, sie mag mit mir schalten, ich preise sie in allen Werken.” Das Gefühl des homo religiosus - die Nähe - zwischen Heinse und Goethe - ist bezeichnend.
Ach, in solch jupitersattem Szenario hätte sich lediglich der auf dem Emanzipationstrip wandelnde junge Heinse wiedergefunden, als er noch der scherzhaften Muse, die sich in rokokohaften Tändeleien gefiel, die Flötentöne austrieb. Statt über säuselnder Winde und buschwindröschenhaftem Voyerismus, wie es in seiner Jugend poetisch en vouge war, macht sich Heinse einen Reim auf orgiastische ,,Regengüsse” und blutspritzende ,,Liebesbisse”. Und merkt sehr schnell, wie einem der Ruf des Erotomanen schadet. Es dauert dreißig Jahre, bis ein gewisser Heinrich von Kleist Heinses lyrischen Geschlechterkampf poetisch überbietet -
und mit dem Liebesmord seiner Amazonenkönig Penthesilea ebensowenig Gnade findet in den Augen des literarischen Trendsetters Goethe wie seinerzeit Heinse bei seinem Mentor Wieland. Der hatte Heinses Vorwurf gegenüber seiner Rokoko-Erotik ebenso gut verstanden, wie Goethe in Kleists Drama nun den trotzigen Gegenentwurf zu seiner Iphigenie sah. Avantgarde sein, künstlerisch zumal, kann lebenszehrend sein.
Heinse jedoch flüchtet sich nicht in den Wahnsinn, aber zunehmend ins ästhetische Exil, in die Abstraktion der Darstellung und in eine Art selbstgewählten Autismus.
,,Hofmeister wurden viele, Minister nur wenige”, lautet der fast sardonische Kommentar zum Schicksal deutscher Literaten der Goethezeit in einer neueren Literaturgeschichte.
Wenn wir Heinses Lebens- und Arbeitsweise als Zeichen gefährdeter Individualität lesen, so sind wir auch hier einem typischen Schicksal der Epoche begegnet - einem innerlich Exilierten, der seine glückseligen Inseln vor allem im Ästhetischen gefunden hat.
Dabei hat Wilhelm Heinse - durch die verschiedensten Lebenserfahrungen früh geprägt -niemals die Kunst als höchste Instanz oder als Kompensationsobjekt einer entgötterten Moderne gepriesen. Wer zu tief im realen Schlamassel steckt, bleibt gewöhnlich skeptisch gegenüber den Rauschmitteln des Idealismus - den großen Theoremen der Politik, Philosophie und Kunst. -
Heinses an die frühe griechische Naturphilosophie angelehntes Ich- und Weltverständnis begreift die Welt als das auseinandergefaltete Wesen, als die in stets neuen Formen mit sich selbst spielende Gottheit. Nach Heinse muß die Welt als göttliches Spiel erfaßt werden, dem die eigene Existenz beizugeben ist.
Eine entsprechend vollkommene, teils einfühlsame teils ins Hymnische sich steigernde Sprache, aus der noch die Vertreter des literarische Expressionismus wie Impressionismus schöpfen werden, findet Heinse auch für seine Naturbilder, für alle Erlebnisse, in denen er sein naturhaftes Vollkommenheitsideal manifestiert sieht.
Die pantheistisch intendierte Ersetzung eines verlorenen personifizierten Gottesbegriffs ist typisch für die Intellektuellen des achtzehnten Jahrhunderts. Eine göttlich durchwaltete Natur hat sich als fixer, das meint: rational nicht hinterfragter Begriff in die traditionelle Theologie hineingedrängt.
Man reißt ihr keine Erklärungen vom Leibe, sagt etwa Goethe über diese Natur. ,,Sie ist alles, ich vertraue mich ihr, sie mag mit mir schalten, ich preise sie in allen Werken.” Das Gefühl des homo religiosus - die Nähe - zwischen Heinse und Goethe - ist bezeichnend.




J.J.Wilhelm Heinse