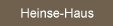Mutter Erde! Tränk in meiner Aue
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Seite
vor
zurück
Die aktuelle bäuerliche Arbeit gerät im Folgenden immer mehr aus dem Blickfeld Müllers, der Streit-Dialog zwischen Walter und dem Schulmeister weitet sich zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über die künstlerische Darstellung der Lebenswirklichkeit aus, zu einer gelehrten Disputation, in der ein Bauer beim Schafescheren die übliche Idyllendichtung verwirft und seinen Gegenentwurf, also das, was Müller eine ‚pfälzische Idylle‘ nennt, dagegensetzt. Ich denke, man muss nicht wie ich als Kind in einem 200-Seelen-Dorf an der fränkisch-thüringischen Grenze aufgewachsen sein, um als unzutreffend zu erkennen, was noch 1976 in einer germanistischen Untersuchung über Müllers Text ausgesagt worden ist: In ihm sei dargestellt, „was bei bäuerlichen Zusammenkünften erzählt und gesungen wurde, worüber man sprach und sich Gedanken machte“.
Deshalb kann das Wort vom Realismus Müllers ausschließlich im Hinblick auf die Lokalisierung des Textes, seine Sprache und auch auf die Argumentationsweise seiner handelnden Figuren gelten. Wenn Walter etwa Natürlichkeit und Schlichtheit in der Kunst fordert, hält der Schulmeister mit den Argumenten der Buchgelehrsamkeit dagegen:
„Warum (...) wären Schulen angelegt, warum Lehrer dazu bestellt, warum Regeln festgesetzt, warum so viele gelehrte Bücher darüber geschrieben worden? Wenn die Poesie, wie er meinet, eine so natürliche, gemeine, leichte Sache wäre, er dürfte ja nur niederschreiben, grad wie er sich ums Herze fühlet. Das wär ein gar leichtes, nicht wahr. Aber (...) wo blieb denn das Edle, das Geschmackvolle, das Schöne, das Gelehrte?“
Walter fährt sofort dazwischen:
„Ist er bald fertig? Blitz und Wetter! Weiß er was, Gevatter Schulmeister, ich bin nun einmal zum Lernen zu alt (...), so will ich in Gottes Namen in meinem alten Sattel forttrotten und geruhig meinen Esel zwischen den Ohren halten (...) Der Donner erschlag mich, Gevatter! du oder ich, einer von beiden ist ein Narr.“
So viel vom gelehrten Streit zwischen dem Bauern und dem Schulmeister über die wahre Poesie. Wir wenden uns nun der zweiten Lebenshälfte Friedrich Müllers zu, die er in Rom verbracht hat.
Mit dem erklärten Ziel, fortan ganz seiner Maler-Begabung zu leben, in Rom die Schätze der Antike und vor allem die Malerei seit der Renaissance zu studieren, um sich in der Ölmalerei zu vervollkommnen, traf Müller Im Oktober 1778 in Rom ein. Da seine Jahrespension, der Reisekosten wegen, die man ihm versagt hatte, schon stark angegriffen war, geriet er seit dem Beginn seines Romaufenthalts in eine bedrängte wirtschaftliche Lage, eine missliche Erfahrung, mit der er von nun an immer wieder fertig werden musste. In Mannheim hatte er noch einige Manuskripte, die ihm weniger gelungen erschienen waren,
vernichtet, alles Andere, zusammen mit vielen grafischen Blättern, wurde in einen großen Koffer verstaut und beim Verleger Schwan hinterlegt.
Deshalb kann das Wort vom Realismus Müllers ausschließlich im Hinblick auf die Lokalisierung des Textes, seine Sprache und auch auf die Argumentationsweise seiner handelnden Figuren gelten. Wenn Walter etwa Natürlichkeit und Schlichtheit in der Kunst fordert, hält der Schulmeister mit den Argumenten der Buchgelehrsamkeit dagegen:
„Warum (...) wären Schulen angelegt, warum Lehrer dazu bestellt, warum Regeln festgesetzt, warum so viele gelehrte Bücher darüber geschrieben worden? Wenn die Poesie, wie er meinet, eine so natürliche, gemeine, leichte Sache wäre, er dürfte ja nur niederschreiben, grad wie er sich ums Herze fühlet. Das wär ein gar leichtes, nicht wahr. Aber (...) wo blieb denn das Edle, das Geschmackvolle, das Schöne, das Gelehrte?“
Walter fährt sofort dazwischen:
„Ist er bald fertig? Blitz und Wetter! Weiß er was, Gevatter Schulmeister, ich bin nun einmal zum Lernen zu alt (...), so will ich in Gottes Namen in meinem alten Sattel forttrotten und geruhig meinen Esel zwischen den Ohren halten (...) Der Donner erschlag mich, Gevatter! du oder ich, einer von beiden ist ein Narr.“
So viel vom gelehrten Streit zwischen dem Bauern und dem Schulmeister über die wahre Poesie. Wir wenden uns nun der zweiten Lebenshälfte Friedrich Müllers zu, die er in Rom verbracht hat.
- Müllers Leben und Arbeit in Italien
Mit dem erklärten Ziel, fortan ganz seiner Maler-Begabung zu leben, in Rom die Schätze der Antike und vor allem die Malerei seit der Renaissance zu studieren, um sich in der Ölmalerei zu vervollkommnen, traf Müller Im Oktober 1778 in Rom ein. Da seine Jahrespension, der Reisekosten wegen, die man ihm versagt hatte, schon stark angegriffen war, geriet er seit dem Beginn seines Romaufenthalts in eine bedrängte wirtschaftliche Lage, eine missliche Erfahrung, mit der er von nun an immer wieder fertig werden musste. In Mannheim hatte er noch einige Manuskripte, die ihm weniger gelungen erschienen waren,
vernichtet, alles Andere, zusammen mit vielen grafischen Blättern, wurde in einen großen Koffer verstaut und beim Verleger Schwan hinterlegt.
vor
zurück







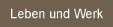

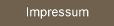
J.J.Wilhelm Heinse