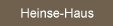Mutter Erde! Tränk in meiner Aue
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Deine Kinder nun mit frischem Thaue,
Und erquicke diese lechzende Flur!
Selig ist der Unschuld die Natur!
Seite
vor
zurück
Dies alles hat Müller nicht mehr unmittelbar erlebt, weil ihm auf seinen dringlichen Wunsch, die Kunstwerke Italiens und vor allem Roms mit eigenen Augen zu sehen und sich an ihnen fortzubilden, Kurfürst Karl Theodor eine auf drei Jahre festgesetzte Pension von jährlich 500 Gulden gewährte, so dass er sich mit neunundzwanzig Jahren seinen Lebenstraum erfüllen konnte, im August 1778 mit der Kutschpost nach Süden reiste und nie mehr von dort zurückkehrte. Wie er sich selbst als einen eleganten Künstler gesehen hat, zeigt ein in Öl gehaltenes Selbstporträt, von dem nicht ganz klar ist, ob es noch in Mannheim oder bereits in Rom gemalt worden ist.
Leider habe ich auch hier keine farbige Darstellung, doch wenn Sie einmal nach Mannheim kommen: im dortigen Reiss-Museum ist es ausgestellt.
Leider habe ich auch hier keine farbige Darstellung, doch wenn Sie einmal nach Mannheim kommen: im dortigen Reiss-Museum ist es ausgestellt.
vor
zurück
Bevor wir im zweiten Teil meines Vortrags Müller nach Rom begleiten, scheint es mir nützlich, einen raschen Blick auf sein literarisches Werk zu werfen, das inzwischen beträchtlich angewachsen war. Bereits 1775 und 1776 brachte Müller bei Schwan jeweils eine Auswahl neuer Gedichte und Balladen heraus, die in Thematik, Haltung und Sprache Gängiges aus der Aufklärungs- und Sturm-und-Drang-Lyrik reproduzierten. Ich lasse sie beiseite und auch eine Reihe von Dramen nach alten Volksbuchstoffen, darunter ein Faust-Fragment. Am interessantesten und auch am folgenreichsten für die Literaturgeschichte sind Müllers Idyllen-Dichtungen. Idyllen zu schreiben war damals Mode, seit der Schweizer Salomon Gessner , in Opposition zu der asketisch-bigotten Grundeinstellung in seiner calvinistischen Heimatstadt Zürich, 1756 eine Sammlung sanft-erotischer, bukolischer Szenen veröffentlicht hatte, die das Landleben in ein verklärendes Licht tauchten. Gessner nannte diese Texte ‚Idyllen‘, sie wurden Bestseller des 18. Jahrhunderts. Abgeleitet war die Gattungsbezeichnung ‚Idylle‘ vom griechischen ‚eidyllion‘ (= kleines Bild), womit ursprünglich kurze, heitere Gedichte bezeichnet wurden. Bereits im Barock spielten Idyllen eine wichtige literarische Rolle in der sogenannten ‚Schäferdichtung‘. In ihr wurde eine Art ländliche Gegenwelt zum Hofleben mit seiner städtisch-steifen Etikette in einer friedvollen Landschaft entworfen, Rollenpoesie von Liebenden in Hexameter-Versen. Aus Gessners Idyllen spricht immer wieder die Sehnsucht nach einer längst verlorenen gesellschaftlichen Harmonie, die Rückwendung in eine idealisierte Vergangenheit. Etwa von 1770 an geriet die Idyllendichtung in die Kritik einer jungen Dichtergeneration, man verurteilte die stereotype Stoffwahl aus mythologischen oder alttestamentarischen Erzählungen und Epen sowie die Abwendung von den Fragen der Gegenwart, die Flucht in eine rückwärts gerichtete Utopie, die sich nicht den drängenden politischen und sozialen Problemen im Vorfeld der Französischen Revolution stellte. Es gilt als Müllers bleibendes literarisches Verdienst,





Bild zum Vergrößern anklicken !



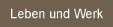

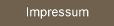
J.J.Wilhelm Heinse